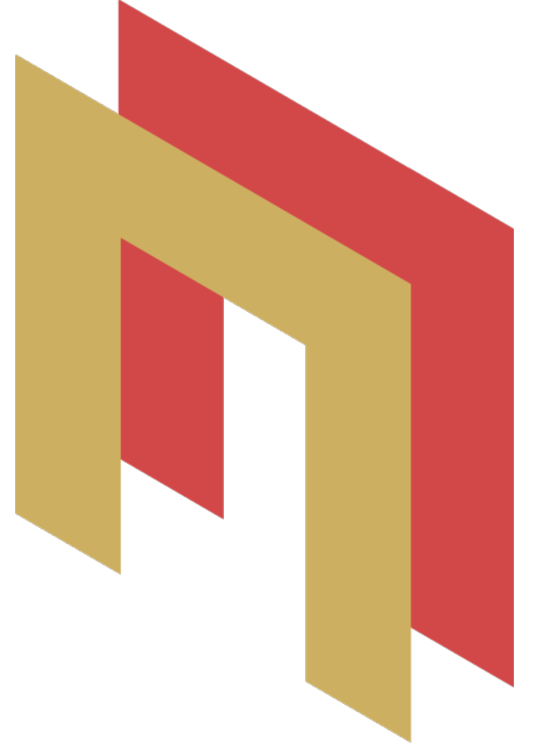Q & A
Genehmigungen, Gutachten & Anträge
Für all unsere Mini-Häuser gilt das gleiche baurechtliche Regelwerk wie für herkömmliche Häuser, wenn sie als dauerhafte Wohnstätte genutzt werden. Die Eignung des Grundstücks muss überprüft werden; hierzu werden die Flächennutzungs- und Bebauungspläne der Gemeinden herangezogen. Es ist unerlässlich, die Vorschriften der entsprechenden Bebauungspläne (z. B. hinsichtlich der Art des Daches, der Dachneigung, der Fassadengestaltung etc.) zu beachten und zu prüfen, um sicherzustellen, dass Ihr neues Haus eine Baugenehmigung erhalten kann. Außerdem müssen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt sowie konstruktionstechnische Vorgaben eingehalten werden und auch die Wasser- und Stromversorgung muss gewährleistet sein.Sie sollten in jedem Fall einen Architekten hinzuziehen, der Sie hinsichtlich der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und beim Baugenehmigungsverfahren unterstützt.
Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet, es gibt 2 Arten von Energieausweisen; den Bedarfsausweis und den Verbrauchsausweis. Der Bedarfsausweis basiert auf der Gebäudekonstruktion und den verwendeten Materialien während der Verbrauchsausweis den tatsächlichen Energieverbrauch des Gebäudes berücksichtigt.
Die Erstellung eines Energieausweises ist bei Neubauten in Deutschland verpflichtend. Er stellt Informationen über die Energieeffizienz des Gebäudes bereit, er gibt Auskunft über den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und mögliche Einsparpotenziale.
Der Energieausweis soll dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, den Energieverbrauch zu senken und somit die Umwelt zu schonen.
Zuständig für die Erteilung der Baugenehmigung ist die untere Bauaufsichtsbehörde, das ist die Kreisverwaltung, in kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten die Stadtverwaltung oder die Verbandsgemeindeverwaltung, wenn ihre Aufgaben der Bauaufsicht übertragen worden sind.
Für die Erteilung der Baugenehmigung fallen Gebühren an, deren Höhe sich im Wesentlichen nach der Art des genehmigten Vorhabens bestimmt. Diese Gebühren werden nach der Landesverordnung über Gebühren und Vergütungen für Amtshandlungen und Leistungen nach dem bauordnungsrecht (Besonderes Gebührenverzeichnis) erhoben. Die Gebühr liegt in der Regel zwischen 0,5 % und 1 % der Baukosten.
Die Bauvoranfrage wird bei der zuständigen Baubehörde gestellt. Diese überprüft, ob ihr Bauvorhaben mit dem Baurecht vereinbar ist und ob und inwieweit das Grundstück bebaut werden kann oder welche Einschränkungen es gegebenenfalls gibt. Die Kosten für eine Bauvoranfrage liegen in der Regel deutlich unter denen für einen Bauantrag und können bei der jeweiligen Behörde erfragt werden.
Eine förmliche Bauvoranfrage muss folgenden Unterlagen enthalten: Antragsformular, Flurkarte, detaillierte Baubeschreibung, detaillierter Fragenkatalog des beauftragen Architekturbüros oder Bauingenieurs, alle Bauzeichnungen, bei gewerblichen Bauvorhaben eine Nutzungsbeschreibung
Ein Bodengutachten ist für private Bauherren rechtlich keine Pflicht. Dennoch ist es ratsam, ein solches Gutachten anfertigen zu lassen, da Sie als Grundstückseigentümer für alle Risiken haften, die durch die Bebauung des Grundstücks entstehen. Wenn es zum Beispiel während der Errichtung zu gravierenden Mängeln im Boden kommt, können die daraus resultierenden Folgekosten sehr hoch sein.
Noch kostspieliger können Schäden sein, die nach der Fertigstellung auftreten; etwa Risse im Fundament durch Bodensenkung, Oberflächenwasser, das nicht absichert und zu Feuchtigkeitsschäden an der Immobilie führt oder ähnliches.
Die jeweilige Landesverordnung über Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung gibt vor, welche Unterlagen mit dem Bauantrag eingereicht werden müssen. Zum Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung gehören mindestens folgende Unterlagen: Lageplan, Übersichtslageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Berechnungen, Entwässerungsunterlagen, Statistischer Erhebungsbogen, Betriebsbeschreibung, Befreiungs-/ Abweichungsantrag, Nachbarbeteiligung
Q & A
Energieeffizienz
Die Geräusche im Wohnraum liegen je nach Stufe zwischen 21 dB und 37 dB. Das Gerät läuft typischerweise bei etwa 20 % seiner Leistung, also auf der kleinsten Leistungsstufe (= 21 dB, etwa Atemgeräusch oder Schneefall).
Beim Heizen wird von der Klimaanlage – ähnlich wie beim Heizkörper – warme Luft erzeugt. Da das EH 40 nur äußerst geringe Wärmemengen benötigt, läuft das Gerät selten und meistens auf niedrigster Stufe. Wenn das Gerät kontinuierlich läuft und der Luftstrom nicht unmittelbar auf die Bewohner gelenkt wird, nimmt man den Heizvorgang nicht wahr. Das Gerät hängt im Wohnraum und ist – wenn überhaupt – nur in dem Raum wahrnehmbar.
Beim Kühlen wird von der Klimaanlage kühle und entfeuchtete Luft erzeugt. Wenn der Kühleffekt moderat genutzt wird, sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Mögliche unangenehme Folgen resultieren meist von übermäßiger Nutzung des Kühleffekts in Verbindung mit der dann sehr trockenen Luft und starkem Luftzug. Das Gerät ist nur für die Beheizung notwendig. Die Betriebsart Kühlen dient ausschließlich dem zusätzlichen Komfort, sie kann, muss aber nicht genutzt werden.
Die Erstellung eines Energieausweises ist bei Neubauten in Deutschland verpflichtend. Er stellt Informationen über die Energieeffizienz des Gebäudes bereit, er gibt Auskunft über den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und mögliche Einsparpotenziale.
Der Energieausweis soll dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, den Energieverbrauch zu senken und somit die Umwelt zu schonen.
Ohne Zusatzmaßmaßnahmen ist eine raumweise Regelung der Temperatur nicht möglich. Erfahrungsgemäß pendeln sich die Temperaturen mit Nutzung der Luft-Luft-Wärmepumpe wie folgt ein:
Wohnraum ca. 22 °C
Badezimmer ca. 22 °C
Hier kann die Temperatur z.B. mit Hilfe eines Heizlüfters kurzfristig für die Nutzungszeit auf 24 °C oder höher angehoben werden.
Schlafzimmer ca. 20°C
Die Schlafzimmertemperatur ergibt sich aus der Temperatur im Wohnraum abzüglich etwa 10% Lüftungsverlust aus der Lüftungsanlage. Wird die Temperatur im Wohnraum zum Beispiel nachts abgesenkt, sinkt im gleichen Maß die Temperatur im Schlafraum. Die Wärmerückgewinnung über die Lüftungsanlage kann zudem zeitweise abgeschaltet werden. Das führt zur weiteren Temperaturabsenkung im Schlafraum. Ist es im Schlafzimmer mit der Regeltemperatur von 20°C zu kalt, kann man mithilfe eines kleinen Zusatzheizkörpers die Temperatur auf die Wohnraumtemperatur oder höher anheben.)
Bei der Erstellung des GEG-Nachweises ist die primäre Energiequelle zu berücksichtigen, das ist immer die Luft-Luft-Wärmepumpe.
Selbstverständlich ist es möglich, eine Elektroheizung oder eine Infrarotheizung z. B. im Bad als Komfort-Zusatzheizung zu nutzen, diese haben allerdings einen etwa 5 x so hohen Energieverbrauch und müssen immer in Kombination mit der Luft-Luft-Wärmepumpe verbaut werden, um den Energieeffizienzstandard zu erreichen.